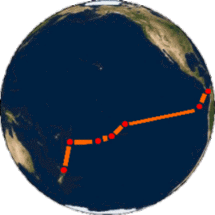DL4FCA mit Amrei auf der SY Sarei um die Welt
DL4FCA Sascha hat bei uns in Mühlheim für seine Lizenz gebüffelt und auch seine Prüfung bestanden. Er ist Jahrgang 1970 und heute Lehrer für die Fächer Physik und Sport. Aus beruflichen Gründen hat es ihn nach Lahr verschlagen.
1999 hat er sich in der DJH-Segelschule für den Kurs "Sportbootführerschein Binnen" angemeldet. Schon damals war es sein Ziel, einmal in die Welt hinaus zu Segeln. Bei der Anmeldung ahnte er noch nicht, daß er nicht nur Segeln lernen sollte, sondern auch gleich seine Segellehrerin mit um die Welt nehmen würde. Es folgten der Sportbootführerschein See und der Sportküstenschifferschein.
Praxis im Yachtsegeln erhielt er durch Törns im Mittelmeer, Atlantik und in der Nordsee.
Jahrgang 1968, Contest 29/ Conyplex/ Niederlande, Länge über Alles : 8,84 m, Länge Wasserlinie : 6,78 m, Breite : 2,50 m, Tiefgang : 1,30 m, Verdrängung : 3,6 t, Balast : 1,4 t, Besegelung: Groß : 16,80 m²,Fock : 15,70 m², Genua : 24,20 m²
Der Start
Der Start
Hier einige Auszüge und Bilder aus den Reiseberichten, mit freundlicher Genehmigung von Sascha (DL4FCA).
Am Sonntag, den 3. August 2003 sollte es losgehen: Amrei und Sascha wollten ihre Weltumsegelung starten.
Zur Verabschiedung hatten sie nach Stevensweert in die Niederlande eingeladen.
In diesem Örtchen hatten die beiden nun alle Wochenenden und freien Tage der letzten Monate verbracht, um ihr Schiff Sarei für die Weltumsegelung klar zu machen.
Schon Wochen vor dem Start der Reise hieß es: „Wir wollen am 3.August 2003 so gegen Mittag los!“
Gesagt – getan!
Von Holland aus soll die Fahrt über verschiedene Kanäle, die Rhone nach Barcelona führen.
Doch dann geht es endlich auf’s Meer. Von den Balearen, durch die Straße von Gibraltar auf die Kanarischen Inseln. Danach auf über den großen Teich nach Brasilien. Die Atlantikküste nach Norden bis Französisch Guayana. Weihnachten 2005 wollen Amrei und Sascha in der Karibik verbringen.
Über Venezuela und Kolumbilen nach Panama,weiter durch den Panamakanal in den Pazifik. Vor dort nach Neuseeland.
Weitere Routenpunkte stehen noch nicht fest.
Aber einmal um die Welt ist das große Ziel.
Avignon
Mit Avignon haben wir fast das Ende unserer Fahrt von der Nordsee ans Mittelmeer erreicht. Nur noch zwei kurze Fahrtage trennen uns vom Salzwasser.
1200km Fahrtstrecke, 224 Schleusen, 5 Tunnels, 3 Aquädukte und 235 Motorstunden liegen hinter uns. Von der Nordsee sind wir auf 360 Höhenmeter gestiegen, ab den Vogesen ging es dann wieder abwärts.
Seit unserem letzten Bericht aus Toul haben wir viel erlebt. Der landschaftlich sehr schöne Canal de l´Est Süd war ein hartes Stück Arbeit. Kaum hatte man eine Schleuse verlassen, kam schon die nächste in Sicht. So passierten wir bis zu 16 Schleusen an einem Tag. Begleitet wurden wir dabei von einem Schleusenwärter oder einer Schleusenwärterin mit dem Moped oder Auto. Beim Öffnen und Schließen der schweren Schleusentore halfen wir kräftig mit, bei eisigen Temperaturen eine willkommene Abwechslung. Morgens war unser Boot mit einer dicken Eisschicht überzogen, so dass wir Mühe hatten die steifgefrorenen Festmacherleinen zu lösen. Das Eis an Deck war auch schuld, dass Sascha, beim Versuch die Leine an Land zu bringen, im kalten Wasser anstatt am Rande der Schleuse landete. Seit diesem Moment ist sich Nils aus Dänemark sicher, dass es auch in Deutschland echte Wikinger gibt!
Das Erreichen des höchsten Punktes feierten wir zusammen mit Geir und Kari aus Norwegen bei einem kräftigen Schluck „Linie Aquavit“, der schon 20 mal den Äquator überquert hat.
In Fontenoy trafen wir auf eine Yacht auf dem Rückweg nach Stuttgart. Vater und Sohn hatten zwölf Jahre in der Karibik verbracht. Bei einem Glas Cola bekamen wir viele wichtige Informationen über die schönsten Ankerplätze, gefährliche Gegenden, das Tauchen mit Haien und erfolgreiches Hochseeangeln.
Auf der Flucht vor der Kälte wurden unsere Etappen auf der Saone immer länger. Wir waren sehr darauf bedacht, abends eine Steckdose für unseren kleinen Heizlüfter zu finden. Leider war das nicht immer möglich, so dass wir morgens auch einmal mit Eis im Boot erwachten.
In Macon gesellte sich Rick, ein Mathelehrer aus London, zu uns. Vor sechs Monaten hat er mit dem Segeln begonnen und ist nun alleine unterwegs auf dem Weg ins Mittelmeer.
In der Millionenstadt Lyon fuhren wir von der Saone in die Rhone. Unsere Reisegeschwindigkeit nahm deutlich zu. Die starke Strömung der Rhone erfordert vor allem bei den An- und Ablegemanövern starke Nerven. Hier stößt unser 10 PS Motor an seine Leistungsgrenze. Eine Stelle, die wir einmal passiert haben, können wir nicht wieder erreichen. Die Rhone ist für uns eine Einbahnstraße. Für kleine Boote gibt es kaum geeignete Anlegeplätze. Der Schwell der großen Frachtschiffe bringt Sarei ganz schön zum Schaukeln. K.O. hatten wir uns gerade ins Bett gelegt, als ein besonders großes Exemplar das Schiff heftig ins Rollen brachte. Augenblicklich waren wir hellwach. Ein lautes Krachen auf Deck ließ nichts Gutes verheißen. Der Mast lag quer über der Reling und im Schlafanzug mussten wir ihn wieder sichern. Rick wurde gar eine Klampe aus dem Rumpf gerissen.
In den Schleusen der Rhone kamen wir uns winzig vor. Die größte überwindet einen Höhenunterschied von 22 m! Es ist ein Gefühl, als ob man in eine Gruft hinabgelassen wird. Da sie aber alle mit Schwimmpollern ausgestattet sind, war es für uns sehr bequem.
Hier in Avignon liegen wir direkt hinter der berühmten St. Benezet Brücke mit Blick auf den Papstpalast. Jetzt fehlt uns nur noch der, für Avignon angekündigte, Sonnenschein. Avignon bedeutet für uns Abschiednehmen. Hier trennen sich die Wege unserer kleinen Gruppe. Die einen fahren über den Winter nach Hause, die anderen ins östliche Mittelmeer und wir wollen weiter in westliche Richtung.
Europa
Europa
Formentera - Gibraltar nonstop, dass sollte unsere erste Langfahrt werden! Endsprechend aufgeregt waren wir in den Tagen davor. Wie immer hatten wir noch eine Liste mit Arbeiten, die erledigt werden mussten. Der Lukendeckel im Cockpitboden brauchte kentersichere Verschluesse, dass GPS musste programmiert und die Seekarten sortiert werden. Als der Wetterbericht fuer die kommenden fuenf Tage nordoestliche Winde um 4 - 5 vorhersagte, legten wir den Abfahrtstermin auf den naechsten Morgen fest. Doch bevor wir Kurs Gibraltar anlegen konnten, mussten wir noch in den Hafen von Formentera um Wasser und Proviant zu bunkern. Dort wollte man von uns 9 Euro fuer ganze zwei Stunden Aufenthalt (ohne das Wasser)! Interessehalber erkundigten wir uns noch nach dem Preis fuer eine Nacht, 65 Euro haette sie fuer unser Boot gekostet. Fuer ein letztes Bad im kristallklaren Wasser der Insel drehten wir eine Stunde spaeter bei und sprangen ueber Bord (nacheinander natuerlich).
Das Meer war ruhig, so dass wir abends im Cockpit sassen und Gemuese fuer einen Eintopf schnibbelten. Das Kochen an Bord ist eine Kunst fuer sich. Einen Moment Unaufmaerksamkeit und schon fliegt eine Schale mit Muesli durchs Boot, die Olivenoelflasche faellt um oder die Kartoffeln rollen auf dem Fussboden. Eigentlich muesste man mehr als zwei Haende haben, um alles unter Kontrolle zu behalten, zumal wir noch keine vernuenftige Topfhalterung haben. Unsere Obst- und Gemueseeinkaeufe waren gut kalkuliert, so mussten wir bis Gibraltar keine Dose aus unserem Vorrat oeffnen.
Sobald die Sonne hinter der Kimm verschwand, schalteten wir die Navigationslichter und das Kompasslicht ein. Jetzt begann unser ueblicher Wachrhythmus, fuer die naechsten drei Stunden verzog sich Amrei in die Koje. Doch an Schlaf war in dieser ersten Nacht auf See noch nicht zu denken, dazu schwirrten uns zu viele Gedanken im Kopf herum. In der zweiten Nacht ging es dafuer um so besser, d.h. aber nicht, dass wir drei Stunden durchschlafen konnten. Beim Segelschiften, Kurswechsel und kritischen Schiffsbegegnungen waren wir immer zu zweit an Deck. Wenn keine Arbeiten zu erledigen waren, schauten wir in den Sternenhimmel oder zu unseren Begleitern, den Delfinen. Wenn sie aus dem Wasser sprangen, war ihre Haut von unzaehligen kleinen Leuchtalgen bedeckt. Das sind fuer uns die schoensten Momente beim Segeln.
Auch tagsueber besuchte uns eine Schule von mindestens 15 Delfinen. Eine Dreiviertelstunde lang verwoehnten sie uns mit einer zirkusreifen Vorstellung. Auf dem Bauch liegend konnten wir sogar ihre Rueckenflossen beruehren.
Fuer das Mittelmeer untypisch kam der Wind bestaendig von hinten und wir freuten uns ueber ein Etmal von 113 Seemeilen. Nachdem Cabo da Gata hinter uns lag flaute der Wind allerdings ab. Verwundert schauten wir auf unser GPS, dort stand, das wir unseren Kurs um 90 Grad aendern sollten. Dabei hatten wir doch immer noch den richtigen Kompasskurs!? Sollte das GPS etwa kaputt sein? Schnell schalteten wir unser Ersatzgeraet ein, doch auch hier die gleiche Anzeige. Sollte an dieser Stelle etwa eine magnetische Stoerung vorliegen? Doch die Loesung war viel einfacher, eine Gegenstroemung hatte uns erfasst und seitlich versaetzt. Fuer zwei Stunden starteten wir den Motor, um nicht zu weit abgetrieben zu werden. Kurzfristig ueberlegten wir einen Ankerplatz an der Kueste anzusteuern. Aber so kurz vor unserem Ziel wollten wir dann doch keinen Stopp mehr einlegen. Der Wind nahm bald wieder zu.
In der letzten Nacht leuchtete uns das Licht von Europa Point den Weg. Dieser beruehmte Leuchtturm von 1841 markiert den suedlichsten Punkt des europaeischen Festlandes. Sascha suchte in der CD-Sammlung die geeignete Musik fuer diesen Augenblick. Was koennte besser zu dieser Stimmung passen, als der Soundtrack von dem Film Titanic. Bei Sonnenaufgang tauchte im Dunst vor uns der gewaltige Felsen von Gibraltar auf: The Rock!
Am Morgen des fuenften Tages fiel der Anker in La Linea de la Concepcion nur einen Steinwurf von Gibraltar entfernt. Unser erster Eindruck war enttaeuschend, die von Industrie und Wohnblocks a la Plattenbau gepraegte Landschaft wirkte wenig einladend. Der Felsen von Gibraltar ist durch eine schmale Landenge mit dem spanischen Festland verbunden. Diese dient gleichzeitig als Hauptstrasse zur Grenze und Fluglandebahn! Trotz seiner imposanten Erscheinung, sichtbar aus hundert Kilometer Entfernung, ist Gibraltar relativ klein, mit einer Flaeche von knapp 6 Quadratkilometern. Natuerlich wollten wir auch die beruehmten Affen besuchen. Zum ersten mal mussten wir an einer Landesgrenze unseren Pass vorzeigen! Direkt dahinter galt es die Fluglandebahn zu ueberqueren. Ein Schild weisst darauf hin, dass man dieses moeglichst schnell tuen und dabei keinen Muell verlieren soll. Nach einer einstuendigen Kletterpartie unter der sengenden Sonne Suedspaniens (oder sollten wir besser Suedengland schreiben?) sichteten wir die ersten Berbermakaken. Einer sass gemuetlich auf dem Rueckspiegel eines parkenden Autos, der andere am Steuer! Gerade wollte Sascha diese Szene Fotografieren, als sich ein weiterer Makake ruecklinks auf ihn stuertzte. Ziel der Attacke war ein Baguette in unserem Rucksack. Geschickt klaute er das Brot und sprintete in den naechsten Baum, unerreichbar fuer uns. Na dann, guten Apettit! Unterbrochen von vielen kurzen Pausen im Schatten von Eukalyptusbaeumen erreichten wir den Gipfel auf 426 m. Von hier aus hatten wir eine tolle Aussicht ueber die Strasse von Gibraltar bis zum Djebl Musa in Afrika, welcher zuammen mit dem Felsen von Gibralter die Saeulen des Herkules bildet. Auf dem Rueckweg spazierten wir durch die Fussgaengerzone, wo sich ein Spirituosenladen neben dem anderen befindet, nur unterbrochen durch Elektroniklaeden.
Jetzt warten wir auf eine passende Gelegenheit, um durch die Strasse von Gibraltar in den Atlantik zu gelangen.
Blick auf Gibraltar



Olhao, Portugal
Am Mittwoch, dem 21.07, sind wir sehr früh aufgestanden, um durch die Strasse von Gibraltar in den Atlantik zu segeln. An der Atlantikseite ist die Strasse etwa 300m, am Mittelmeereingang über 1000m tief. Eine kräftige Strömung fließt an der Oberfläche ins Mittelmeer, um das durch Verdunstung verloren gegangene Wasser wieder aufzufüllen. Am Rand läuft die Strömung abwechselnd ost- und westwärts. Wir wollten uns deshalb möglichst nah an der spanischen Küste halten. Am Anfang wehte noch eine leichte Brise aus Ost. Bis Tarifa, der engsten Stelle, nahm der Wind jedoch stark zu. Hervorgerufen durch die unterschiedlichen Strömungen, schien das Wasser um uns herum zu brodeln und zu kochen. Mit acht Knoten rauschten wir in eine Nebelwand und um uns herum verschwand alles im dichten Weiß. Zwei Seemeilen nach dem Nadelöhr beruhigten sich die Elemente wieder und wir konnten entspannt unserem Ziel entgegensegeln. „Schau mal Amrei, was für ein großer Schmetterling!“ Der Schmetterling entpuppte sich als Fledermaus, die es sich, nach mehrmaligen Landeversuchen, auf unserer Windfahnensteuerung bequem machte. Kopfüber hing sie da in der prallen Sonne und wir machten uns langsam Sorgen, ob sie überhaupt noch lebte. Als wir in der Abenddämmerung unseren Ankerplatz erreichten, wurde unser Gast plötzlich wieder munter. Er streckte und reckte sich, putzte sein Fell und flog in die Nacht hinaus.
Nach vielen Wochen vor Anker, segelten wir in die Marina von Cadiz. Da es angeblich keinen Platz für Boote von 8 – 10m gab, sollten wir für 11 – 13m zahlen. Das hat uns sehr geärgert, zumal unser Liegeplatz für Boote von mehr als 9m nicht geeignet war!
Cadiz hat uns dafür reichlich entschädigt. Die Musik von Pauken und Trompeten begleitete unseren ersten Ausflug in die Stadt. Jungendliche übten auf der Strandpromenade schwere andalusische Melodien ein. In den Strassen, die so schmal sind das keine Autos fahren können, beginnt das Leben erst nach Einbruch der Dunkelheit. Die Cafes füllen sich, Kinder spielen auf den Plätzen und die Erwachsenen tauschen Neuigkeiten bis weit nach Mitternacht aus. Dies ist auch die bevorzugte Zeit für Schaben (Kakerlaken). Zu tausenden krabbeln sie aus den Gullydeckeln und bei jedem Schritt knirscht es verräterisch unter den Schuhen. Einen dieser munteren Gesellen entdeckte Amrei im Cockpit von SAREI! Zum Glück blieb es bei diesem Einzelfall.
Das Wetter auf den nächsten Etappen hätte besser ins Mittelmeer gepasst. Plötzlicher Wechsel der Windrichtung und –stärke, meistens aber ein leichter Gegenwind, strengten uns sehr an.
Mit Rückenwind und mitlaufender Tide segelten wir den Rio Guadiana hinauf. Entspannt ließen wir die hügelige Landschaft an uns vorbeigleiten, nur beobachtet von den Störchen, die am Ufer nach Nahrung suchten. Als die Tide schließlich kippte, ließen wir den Anker fallen und genossen die ruhige Nacht unter einem wunderschönen Sternenhimmel. Am nächsten Morgen segelten wir auf dem Grenzfluss zwischen Spanien und Portugal weiter bis zu der kleinen Ortschaft Sanlucar. Schon von weitem sahen wir den Katamaran „Manua Siai“, den wir aus unserem Buch „Untergehen werden wir nicht“ (Bettina Haskamp und Gerhard Ebel) kannten. In dem Ort trafen wir dann auch noch Gerhard und verbrachten einen schönen Abend zusammen.
In Sanlucar nahmen wir auch ein neues Crewmitglied an Bord: Jed! Jed ist eine Kultur und seine Aufgabe ist es uns alle zwei Tage mit frischem Joghurt zu versorgen. Bekommen haben wir ihn von Orit und Simon die mit ihrem Katamaran Taulua auf dem Weg ins Mittelmeer sind. Zwei Tage segelten wir zusammen den Fluss wieder runter.
Unser nächstes Ziel war die Lagunenlandschaft von Faro und Olhao. Dieses Gebiet erinnert ein wenig an die deutsche Wattensee und bei Ebbe graben hunderte Portugiesen im Mud nach Muscheln. In Olhao gibt es eine Marina, die noch nicht offiziell eröffnet und somit kostenlos ist. Wasser gibt es an einem kleinen Trinkbrunnen in der Nähe der Marina. Mit einem selbst gebastelten Schlauchadapter ist es möglich das Wasser in die Kanister umzuleiten.
Hier hat sich eine nette Gruppe von Fahrtenseglern gebildet und wir tauschen Bücher, Seekarten und wertvolle Informationen aus. Jetzt stecken wir mitten in den Vorbereitungen für die erste große Atlantiketappe nach Madeira.
Atlantik
Atlantik
Die Kanarischen Inseln
08.11.04 Arguineguin (Gran Canaria)
Erholsame Wochen auf den Kanarischen Inseln! Mit vielen schönen Segeltagen, netten Bekanntschaften und urtümlichen Landschaften überrascht uns die Inselgruppe westlich von Afrika.
Im Hafen von Arrecife, der Hauptstadt Lanzarotes, ist Sascha für eine Woche „Strohwitwer“. In nur viereinhalb Stunden legt Amrei die Strecke zurück, für die wir über ein Jahr gebraucht haben, um in Deutschland ihre Familie und Freunde zu besuchen. Mit im Gepäck ist natürlich auch eine lange Liste dringend benötigter Ausrüstungsgegenstände. So sind Rucksack und Tasche bei der Rückkehr prall gefüllt. Während des Auspackens, später an Bord, macht sich Weihnachtsstimmung breit.
Unter anderem hat Amrei fünf superhelle, weiße LED´s mitgebracht. Jetzt kann Sascha endlich das langersehnte, stromsparende Ankerlicht bauen. Beim Schiffsausrüster kaufen wir noch ein herkömmliches Ankerlicht mit Fresnelllinse in die er die LED´s samt Vorwiderstände einbaut. Am Abend leuchtet es sehr hell und gut sichtbar über den Ankerplatz.
Mit einem „Pot Luck“ feiern wir am 19. Oktober Sascha´s zweiten Geburtstag auf See. Jeder bringt etwas zu Essen und zu Trinken mit und man kann sich von Herzenslust (und nach Hungergefühl) von dem Buffet bedienen.
Weiter führt uns die Reise nach Fuerteventura. Beim Einkaufsbummel im Süden der Insel erregt eine große Bühne unsere Aufmerksamkeit. Die Band ist gerade beim Soundcheck und der klingt wirklich gut. Das Konzert soll um 22 Uhr beginnen. Pünktlich stehen wir in der dicht gedrängten Menge auf dem großen Platz. Ob jung oder alt, Mann oder Frau, alle kennen die Texte der spanischen „In-Band“ „Melendi“ auswendig und die Stimmung ist ausgelassen. Unter einem sternenklaren Himmel verklingen spät in der Nacht die letzten Töne.
Schon am nächsten Tag setzen wir wieder die Segel, da wir Sascha´s Vater auf Gran Canaria treffen wollen. Der Wind meint es gut mit uns, und so fällt der Anker um halb vier nachts in Arguineguin.
Die Wiedersehensfreude ist groß und wir verbringen gemeinsam ein paar sonnige Tage am Strand von Playa del Ingles.
Bei einem Tagestörn stecken wir Alfred mit unserer Segelbegeisterung an. Bei Wind und plätschernden Wellen würde er am liebsten an Bord bleiben und sich in den Schlaf schaukeln lassen.
Jetzt freuen wir uns auf eine weitere Woche mit Alfred, bevor er wieder nach Deutschland muss. Danach heißt es auch für uns wieder arbeiten. Wir wollen „Sarei“ aus dem Wasser heben, um den Rumpf neu zu streichen und ein paar kleinere Reparaturen zu erledigen.
Teneriffa
Mittwochabend 17.11.04, das Nudelwasser kocht bereits als uns lauter Motorenlärm ins Cockpit lockt. Ein großes, dunkelblaues Speedboot umkreist SAREI. Ein heller Suchscheinwerfer blendet uns. „Aduanas, Customs“, hören wir sie rufen. Schnell suchen wir unser Pässe und Bootspapiere. „Wir kommen rüber!“, und schon kracht der erste Zöllner in unsere Seereling. Der Zweite nimmt mehr Schwung, kommt weiter und landet mit einem Fuß im Fenster unserer Sprayhood. Ein langer Riss klafft im Plastikmaterial. Sein anderer Fuß verfehlt knapp unser gläsernes Solarpanel.
Sichtliche Schwierigkeiten haben die beiden mit unseren Reisepässen: „Welche Nationalität? Was ist der Name, Nachname etc.?“ Nach einer halben Stunde sind endlich alle Formulare ausgefüllt. Sie geben uns noch eine Telefonnummer unter der wir den Schaden reklamieren können.
Den Rückweg übernehmen sie auf ähnlich abenteuerliche Weise wie den Hinweg. Da wird dann auch mal der oberste Draht der Seereling als Sprungschanze benutzt, mit dem Resultat einer verbogenen Relingsstütze. Solche Kleinigkeiten können einen echten „Rambo“ doch nicht aufhalten. Uns jedoch hat dieser Besuch gründlich die Laune verdorben.
Am nächsten Tag segeln wir nach Pasito Blanco, wo schon der Kran auf uns wartet. Langsam hebt sich der Rumpf aus dem Wasser. Ein Meeresbiologe hätte wahrscheinlich die reinste Freude an unserem Unterwasserschiff (obwohl Sascha alle zwei Wochen getaucht ist um alles abzukratzen). Zunächst rücken wir dem „Kleingarten“ mit Spachtel und Hochdruckreiniger auf dem Leib. In mühevoller Handarbeit schleifen wir die alte Farbe glatt. Kleine Kratzer werden mit Epoxyspachtel gefüllt. Während wir so beschäftigt sind, versuchen die Mitarbeiter der Marina Kontakt mit der Zollbehörde in Las Palmas aufzunehmen. Wir machen Fotos von dem Schaden, senden diese per Email an einen Segelmacher, der wiederum faxt einen Kostenvoranschlag zum Zoll. Ob wir jemals Geld zurückbekommen ist jedoch ungewiss.
Wir sind gerade beim Lackieren, als uns ein junger Mann anspricht: „Wollt ihr zufällig über den Atlantik? Ich suche noch eine Mitsegelgelegenheit!“ Solche Anfragen kommen in den nächsten Tagen noch öfter. Im Hinblick auf unser 8,85m kleines Boot, können wir jedoch diese Wünsche nicht erfüllen.
Nach drei Tagen Arbeit soll SAREI wieder ins Wasser kommen. Mit etwas Sorge schauen wir auf das bevorstehende Manöver. Bei starkem Seitenwind müssten wir eine lange schmale Gasse rückwärts motoren. Aber bei Rückwärtsfahrt lässt sich unser Langkieler nun mal nicht steuern. Wir fragen den Kranführer, ob er uns mit seinem Boot rauszieht. So im Schlepp kommen wir sicher und ohne unnötige Aufregung aus dem engen Hafenbecken.
In einer Nacht segeln wir nach Teneriffa. Unser Ziel Las Galletas ist jedoch so überfüllt, das wir nach einigen, missglückten Ankerversuchen wieder Segel setzen und nach Los Cristianos weiterfahren.
Auf Teneriffa wollen wir wandern gehen und natürlich das Museum von Thor Heyerdahl besuchen. Zu seinen Lebzeiten hat er es selber gegründet und geführt.
Von unserem Ankerplatz aus können wir schon La Gomera, unsere letztes Ziel auf den Kanarischen Inseln, sehen. Zu Weihnachten wollen wir dann auf den Kapverdischen Inseln sein. Wir wissen nicht ob es dort ein Internetcafe gibt. So kann es sein, das der nächste Bericht erst wieder aus Brasilien kommt. Bleibt uns also treu und freut euch auf neue exotische Abenteuer.
Die Kapverden
Baia Palmeira, Sal (Kapverdische Inseln)
San Sebastian auf La Gomera ist ein typischer „Absprunghafen“. Jeden Tag signalisiert das Tuten von unzähligen Nebelhörnern, dass wieder eine Jacht Richtung Karibik oder Kapverden ausläuft. Auch unsere SAREI füllt sich täglich mehr mit Lebensmitteln. Bald schon gleicht sie einer segelnden Speisekammer. Wir liegen merklich tiefer im Wasser! Trotzdem quälen uns Fragen wie: „Haben wir genügend Tomatensauce, wie lagern wir die Eier und Kartoffeln am besten und wie viel Kilo Reis brauchen wir noch?“
Gerüchte gehen um, dass es auf den Kapverden nichts zu kaufen gibt, also soll unser Proviant notfalls bis Brasilien reichen. Einen ganzen Tag brauchen wir um Kartoffeln in Zeitungspapier einzuwickeln, Dosen zu sortieren und das Obst zu waschen.
Abends, als alles verstaut ist, und wir uns wieder bewegen können, klopft es an der Bordwand und Henry lädt uns zum Kinoabend auf sein Boot ein. Es läuft: „Der Sturm“! Genau der richtige Film für den letzten Abend im sicheren Hafen. Henry ist selber Filmproduzent und möchte unsere Abfahrt in eine Dokumentation für den Bayerischen Rundfunk einbauen (Reihe: „Fernweh“, BR).
Am nächsten Mittag gilt das Hupkonzert endlich uns. Begleitet von dem Winken vieler Freunde und natürlich Henrys Fernsehkamera tuckern wir aus der Marina. Nur unter Großsegel sorgt der kräftige Wind dafür, dass die Entfernung zwischen uns und den Kanaren schnell größer wird. Der Südweststurm der vergangenen Woche hat uns eine hohe Kreuzsee hinterlassen. Wellen bis dreieinhalb Meter erschweren uns das Bordleben. Als Sascha gerade das, von Amrei vorgekochte, Chili aufwärmen möchte, trifft uns eine besonders hohe Welle. Wie ein Geschoß wird der Schnellkochtopf durch die Kajüte katapultiert, Sascha hinterher. Der Topf wird von der Bordwand aufgehalten, Sascha von einer scharfen Kante am Tisch (nur eine kleine Fleischwunde am Fuß). Mit einer 20 cm hohen Flamme quittiert der Petroleumkocher seinen Dienst. Für die nächsten sechs Tage bleibt die Küche leider kalt.
Der kräftige Nordost-Passatwind treibt uns schnell voran. Fasziniert schauen wir auf das Herannahen der hohen Wellen. Kommt SAREI ins surfen, schnellt das Log auf 8-9 Knoten hoch! Auch unser Adrenalinspiegel steigt, aber die Windfahne hat das Boot sicher im Griff.
Nachts verschwimmt der Unterschied zwischen Himmel und Meer. Wir segeln unter einem Sternenzelt mit unzähligen Sternschnuppen. SAREI zieht eine leuchtende Furche durchs Wasser. Ab und zu findet eine Welle den Weg ins Cockpit und lässt Kissen und Füße leuchten.
Die wichtigste Unterstützung für unsere langen Nachtwachen ist die Musik! Zu unserem Entsetzen können wir dem CD-Player nach der ersten Hälfte der Nacht keinen Ton mehr entlocken. Als Notlösung bastelt Sascha ein langes Kopfhörerkabel vom „Ghettobluster“ im Vorschiff bis zum Cockpit.
Als die Sonne aufgeht entdeckt Amrei ein kleines Loch im Großsegel. Wir bergen das Tuch und reparieren die Stelle mit Segeltape. Doch nach wenigen Stunden ist ein neues Loch entstanden. Am Ende der Steuerbordsaling hat sich ein Splint aufgebogen!
Wir überlegen hin und her, doch wenn wir die Spitze nicht entfernen können, wird immer wieder ein neuer Riss entstehen. Notgedrungen machen wir den Bootsmansstuhl klar, um in den Mast zu klettern. Eine unangenehme und schmerzvolle Angelegenheit bei hohem Seegang mitten im Atlantik. Gerade als Sascha auf Höhe der Salinge angekommen ist, kommt eine Schule Delfine zu Besuch. Ein toller Anblick von da oben!
Wir beobachten „Fliegende Fische“, die vor ihren Feinden hunderte von Metern durch die Luft fliehen. Immer mal wieder hat einer das Pech, sich auf dem großen Ozean gerade unsere 8,85m als Landeplatz auszusuchen. Da uns der Sinn nicht nach Sushi steht, haben wir leider nichts davon (unser Herd ist kaputt). Amrei sieht eine „Portugisische Galeere“ vorbeitreiben, eine Segelqualle die mit ihren langen Nesselfäden lebensbedrohende Verletzungen hervorrufen kann. In Zukunft schauen wir vor dem Händewaschen genauer hin.
Nach sechs Tagen und 787 Seemeilen fällt unser Anker in der Bucht von Palmeira auf Sal. Das war unsere bisher schnellste Etappe!
Nachdem wir uns ausgeschlafen haben, machen wir uns auf den Weg zum Einklarieren. In dem staubigen Dorf Palmeira gibt es nur wenige Häuser. Bald haben wir das „Polizeibüro“ ausfindig gemacht. Seine Einrichtung besteht aus nicht viel mehr als einem leeren Schreibtisch, einer Holzbank, einem alten Regal mit 10 Ordnern, einem Fernseher und einer Dose Insektenvernichtungsspray. Wir füllen zwei Formulare aus, bezahlen 100 kapverdische Escudos (entspricht einem Euro) und der Beamte drückt uns die Einreisestempel in die Pässe. Den Besuch der zweiten Station, die Schifffahrtspolizei, verschieben wir auf später, da das Büro momentan geschlossen ist. Auf dem Rückweg lassen wir die Eindrücke dieser, anderen Welt auf uns wirken. Wir kommen an der einzigen Wasserstelle des Dorfes vorbei. In Schüsseln und Kanistern holen die Einheimischen das Wasser ins Haus. Da es auf dieser Insel nur ca. 6 Tage im Jahr Regen gibt, kommt das Wasser aus einer Entsalzungsanlage.
Überall begegnen uns nette, freundliche Menschen. In einer Mischung aus Kneipe und Einkaufsladen fragen wir nach Brot, sofort führt uns jemand zum richtigen Laden. Wir fühlen uns auf Anhieb wohl.
Gemeinsam mit zwei französischen Familien besteigen wir nachmittags ein „Aluguer“. Das sind Pritschenwagen, auf deren Ladefläche man für umgerechnet 50 Cent bis 1€ mitfahren kann. Das Ziel der Fahrt ist ein Vulkankrater, in dem aus Meerwasser Salz gewonnen wird.
Am 25.12 haben die Franzosen ein großes Weihnachtsfest für die Segler organisiert. Am Strand wird ein Schwein gegrillt, dazu gibt es Couscous, Kartoffeln, Tomaten und natürlich jede Menge Wein. Auf dem Rückweg zum Boot treffen wir Josef, er lädt uns zu einem Drink nach Hause ein. Der Pfad führt durch Gestrüpp und wir stehen vor einer, aus rohen Brettern zusammengenagelten Hütte mit einem Dach aus Plastikfolie. Hier wohnt Josefs Familie auf wenigen Quadratmetern zusammen mit ein paar Freunden. So etwas haben wir bis jetzt nur um Fernsehen gesehen.
Apropos Fernsehen, mit uns am Ankerplatz liegt die „Frydis“. Das Schiff von Heide und Erich Wilts. Sie sind bekannt durch zahlreiche Bücher und Dokumentationen vor allem aus der Antarktis und Kap Hoorn.
In ein bis zwei Tagen wollen wir noch zu weiteren Inseln der Kapverden segeln, bevor wir Kurs auf Brasilien nehmen.
Südamerika
Südamerika
Über den Atlantik nach Südamerika
Salvador do Bahia de Todos os Santos (Brasilien), 31.01.05
Schneller Start – der Nordatlantik
Die Segel sind gesetzt, Sascha holt den Anker hoch, wir nehmen die Schoten dicht und starten zu unserem großen Törn. Diesmal ganz still, ohne tutende Fanfaren, verlassen wir unseren Ankerplatz auf Santiago (Kapverden). Zwei Abende zuvor haben wir noch mit Freunden zusammen Silvester gefeiert. „Nach Fernando de Noronha wollt ihr? Oh, das ist aber teuer! Eine bekannte Segelyacht musste dort 300 Dollar bezahlen.“ Wir werden etwas blasser und ändern kurz entschlossen unsere Pläne. Das neue Ziel heißt Salvador do Bahia, „nur“ 800 Seemeilen weiter weg.
Schon nach zwei Seemeilen verschwindet die Insel im Dunst des Saharastaubes. Für die nächsten drei Wochen werden wir nur Wasser und Himmel sehen!
Der Nordost-Passat mit Stärke 6 bringt uns schnell voran, schon nach 24 Stunden können wir unser Rekordetmal von 150 Seemeilen verbuchen. Die nächsten Tage geht es so weiter.
Täglich freuen wir uns auf die Sendung von INTERMAR. Das ist eine Gruppe von Funkamateuren, die Segler auf der ganzen Welt begleiten und mit Wetterinformationen versorgen. Auch wir bekommen unseren persönlichen Wetterbericht und können zudem verfolgen, wo sich unsere Freunde befinden. Auf der Homepage von INTERMAR (www.intermar-ev.de) kann man auf einer Weltkarte unsere aktuelle Position sehen. Wir sind dort unter Saschas Rufzeichen DL4FCA zu finden.
Die Entdeckung der Langsamkeit – die Doldrums und der Äquator
Seit gestern Abend hat der Wind merklich abgeflaut. Der Himmel und die See sind bleigrau. Wir haben die Doldrums erreicht.
Die Doldrums bilden die Zone, in der die Passatwinde der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel aufeinander treffen. Sie sind gekennzeichnet durch Windstille oder unstete leichte Winde. Das Wort Doldrum ist eine Verbindung von „dolt“ und „tantrum“, Tölpel und Wüterich. Zu Zeiten der großen Rahsegler starben manche Seeleute eines schrecklichen Todes, wenn sie in diesem Niemandsland am Äquator festsaßen.
Auch wir fühlen uns unbehaglich in diesem grauen Einerlei. Nachts blitzt und donnert es unaufhörlich und immer wieder prasselt ein dicker Regenschauer auf uns hernieder. Bei Temperaturen von 28°C und 85% Luftfeuchte sind wir schweißgebadet und das Leben an Bord wird anstrengend.
Endlich können wir die Fische beobachten, die uns auf unserer Fahrt begleiten. Am Heck des Bootes schwimmt eine Gruppe Goldmakrelen. Sie präsentieren sich in den schönsten Farben. Amrei läuft das Wasser im Mund zusammen: „Schnell Sascha, hol die Angel!“ Sascha zögert noch, sucht dann aber den neuen rosa Gummiköder. Eine Minute später hängt ein prächtiger Brocken am Hacken. Es ist gar nicht so einfach, dieses Muskelpaket zu bändigen. Ein paar Tropfen Alkohol hinter die Kiemen bringen ein schnelles Ende. Bald schon gleicht das Cockpit einem Schlachthof, doch wir werden mit vier riesigen, frischen Filets belohnt. Trotzdem ist unsere „Angelleidenschaft“ für´s erste gestillt!
Mittlerweile haben wir uns an das langsame Tempo gewöhnt und freuen uns, wenn wir mit einem Knoten in die richtige Richtung treiben (und nicht rückwärts). Unser Tagesetmal beträgt 22 Seemeilen!
Schon lange bevor es soweit ist, sind wir gespannt auf den Äquator. Am 14.01.05 um 0249 UTC haben wir es geschafft, wir überqueren den Äquator, Breitengrad 0.
Als die Sonne aufgeht, drehen wir bei, um das Ereignis mit einem Glas Sekt zu feiern. Amrei spendiert Neptun einen Schluck und entdeckt dabei eine Flaschenpost, die wir eingefangen haben. Ein Brief von Neptun höchstpersönlich. Er ist ein bisschen verärgert, dass er so wenige Opfergaben bekommen hat. Zur Versöhnung schlägt er vor, dass der Kapitän Amrei den Navigator Sascha heiraten könnte! Der Kapitän sagt zu und gleich gibt es noch einen Schluck Sekt.
Von Zeit zu Zeit sichten wir andere Schiffe. Meistens ist der Abstand groß genug. Nur einmal müssen wir den Kurs ändern, da uns der Frachter „Athos“ bedenklich nahe kommt. Tausende Kilometer Wasser und dieses Schiff kreuzt genau unsere Kurslinie! Deshalb gehen wir ständig Wache!
Wir sichten auch schwimmende Ölfässer und Container, die zwischen den Wellen nur schwer zu entdecken sind.
Segeln mit dem großen Löffel – der Südatlantik
Nach vier Tagen stellt sich ein leichter Südostwind ein. Er hält durch und es folgen angenehme Segeltage. Das Meer ist wieder tiefblau und nachts zeigt uns das „Kreuz des Südens“ den Weg. Wir lesen viel und genießen es, Zeit zum Nachdenken und Träumen zu haben.
Ein Schwarm Seevögel hat herausgefunden, dass SAREI eine bequeme Rast- und Reisemöglichkeit bietet. Die „ausschlagende“ Windfahne erschwert den Landeanflug jedoch erheblich. Schließlich haben sich drei der Vögel einen Platz erkämpft, alle anderen werden lautstark verscheucht. Sie meinen wohl, dass unser Boot zu klein ist für weitere Passagiere. Die zutraulichen, krähenähnlichen Vögel putzen erst mal ihr schwarzes Gefieder und suchen sich einen bequemen Halt mit ihren Schwimmflossen. Bei Sonnenaufgang werden sie munter und gehen auf die Jagd, um abends pünktlich ihren angestammten Platz wieder einzunehmen. Uns bleibt es überlassen, morgens sauber zu machen.
„Land in Sicht!“, am Horizont tauchen die ersten grünen Hügel von Brasilien auf. Einige Stunden Später segeln wir an der imposanten Skyline von Salvador vorbei in die Bahia de Todos os Santos. Der Lärm der Stadt ist für unsere Ohren noch ganz ungewohnt.
Nach 23 Tagen und 2028 Seemeilen fällt der Anker im überfüllten Hafenbecken.
Schon am nächsten Morgen startet unser neues Abenteuer: Einklarieren in Brasilien. Von einer benachbarten schwedischen Yacht bekommen wir letzte Instruktionen. Nicht weniger als vier Behörden müssen in der richtigen Reihenfolge aufgesucht werden. Überall füllen wir portugiesische Formulare aus, auf denen z.B. gefragt wird: „Wie viele Tote hatten sie an Bord? Wann war die letzte Entrattung? …
Nach einem Tag haben wir endlich alle erforderlichen Papiere und sind jetzt offiziell in Brasilien.
Die Vorbereitungen für das größte Fest im Jahr laufen auf Hochtouren und auch wir freuen uns schon auf den Karneval in Brasilien!
Für alle, die zuhause eine Atlantiküberquerung nachempfinden möchten:
Anleitung für den "Atlantiküberquerungssimulator - AÜS"
Suche dir einen kleinen Raum: Abstellkammer, VW Bus, etc. Kaufe Lebensmittel und Wasser für ca. einen Monat ein. Stelle den Raum auf ca. 20° Schräglage. Die Raumtemperatur sollte 28° - 30°C betragen, bei einer Luftfeuchte von 80 - 90%. Nimm eine Blumenspritze und verteile überall Salzwasser. Stelle nachts den Wecker alle drei Stunden und setzte dich für drei Stunden mit einem Discman auf einen nassen Stuhl und schaue aus dem Fenster nach Frachtern (nicht Einschlafen!). Wenn es nicht regnet kannst du das Fenster zum Lüften öffnen. Wasche dich und putze die Zähne mit Salzwasser. Zur Belohnung darfst du alle 24 Stunden ein Gummibärchen essen. Verlasse diesen Raum nicht für 23 Tage! Herzlichen Glückwunsch, du bist auf der anderen Seite angekommen!
Jacare
Jacare
Schon beim Frühstück sind wir ganz aufgeregt. Heute soll sich ein großer Wunsch von uns erfüllen: Zusammen mit Asmat wollen wir mit Rogers Dschunke segeln gehen. Roger ist ein bisschen nervös. Nach 18 Jahren Einhandsegeln ist er so viel „überflüssige“ Crew nicht mehr gewöhnt. Da noch kein Wind weht, erklärt uns Roger die Funktionsweise seines Dschunkenriggs.
Nachdem wir die beiden Segel gesetzt haben, gleiten wir langsam aus dem Ankerplatz in die Bahia. Fasziniert schauen wir zu den schönen Segeln. Gleich einer Testcrew für eine Segelzeitschrift prüfen wir das Boot auf Herz und Nieren. Wir probieren sämtliche Segelmanöver Reffen, Wenden, Halsen etc. Doch die wirkliche Leistungsfähigkeit zeigt sich, als Freunde mit einer Reinke zum Wettsegeln auftauchen. Fieberhaft trimmen wir die Segel, ziehen hier an einer Leine, lassen dort einen Zentimeter lose. Unser Erstaunen ist groß, die 2m längere Reinke, ausgestattet mit neuen Segeln und Faltpropeller, kommt auch nicht höher an den Wind als Rogers Dschunke mit ihren Segeln, die so alt sind wie das Boot. Erst als sie auf dem Konkurrenzboot die große Genua setzten, schaffen sie es uns zu überholen. Abends, beim gemeinsamen Essen, steht für uns fest, unser nächstes Boot wird ein Dschunkenrigg haben.
Lange genug waren wir nun in der Bahia, uns zieht es weiter Richtung Norden. Doch so einfach ist es dieses Mal nicht! Die ersten zwei Tage müssen wir uns mühsam, hart am Wind, vorankämpfen. Zwei bis drei mal am Tag tauchen dicke schwarze Wolken am Himmel auf, sog. „Squalls“. Manchmal werden sie begleitet von starken Windböen, aber immer von sintflutartigen Regenfällen. Nicht schlecht staunen wir, als sich aus einem dieser Ungetüme ein dünner Schlauch bildet. Wenig später erreicht er die Meeresoberfläche und die Röhre verfärbt sich dunkel. Wie von einem gigantischen Staubsauger wird das Wasser nach oben gesaugt. Wir sind froh, dass wir in ausreichendem Abstand an der Wasserhose vorbei segeln. Noch einmal schauen wir nach achtern, wo sich ein wunderschöner Regenbogen gebildet hat, von der Gefahr ist nichts mehr zu sehen.
Segeln ist halt nie langweilig!
„Sascha, wach auf, komm mal schnell an Deck, der blendet mich an!“ Als Sascha seinen Kopf aus der Luke streckt, sieht er ein großes Containerschiff auf Parallelkurs. Sein heller Suchscheinwerfer strahlt genau in unser Cockpit. Wir geben mit unserer starken Lampe Lichtzeichen und leuchten unsere Segel an. Daraufhin beschleunigt der Frachter seine Fahrt wieder und verschwindet schon bald am Horizont. Er wollte wohl nur überprüfen, ob bei uns alles in Ordnung ist. Auch tagsüber haben wir jetzt viel „Berufsverkehr“. Und alle haben scheinbar die selbe Kurslinie gewählt. Viele wollen sich die beiden Abenteurer genau ansehen und fahren so nahe vorbei, dass sie uns von der Brücke aus zuwinken können.
In einer flachen Lagune, hinter einer kleinen Insel, möchten wir für zwei Tage rasten. Laut Handbuch müsste die Zufahrt zur Lagune tief genug sein. Tatsächlich zeigt unser Echolot bei Hochwasser nur einen fingerbreit Wasser unter dem Kiel. Ganz schön aufregend! Einheimische zeigen uns die Fahrrinne, und wir werden mit einem traumhaften Ankerplatz belohnt.
Nach einem weiteren Tag gemütlichen Segelns erreichen wir den kleinen Ort Jacare in dem Fluss Paraiba.
In weißem, wehendem Gewand, wird ein Saxophonist aufs Wasser gerudert. Nach den einleitenden Klängen der „Eurovisionsmelodie“ legt der Musiker los, um in den nächsten zwanzig Minuten Ravels „Bolero“ durch zu hauen. Dieses Spektakel wird hier nicht etwa zu unserem Empfang inszeniert, sondern ist tägliches Ritual zum Sonnenuntergang.
Die nächsten Wochen wollen wir im Fluss verbringen. Wahrscheinlich werden wir flüchten müssen, sollten wir jemals wieder, nach dieser Zeit, irgendwo in dieser Welt den Bolero hören…
Fahrtensegeln ist: Segeln zu den schönsten Ankerplätzen der Welt, um dort sein Boot zu reparieren!
Strömung: 3 Knoten im Fluss, Amrei sitzt in unserem Dingi, Sascha und Brett in „Merluzas“ Dingi. Verbunden sind wir durch unseren neun Meter langen Holzmast. Das Ziel ist der Dingisteg am Ufer. Puh, das war knapp! Mit dem Vorderteil schaffen wir es gerade an dem ankernden Katamaran vorbei, jetzt droht Amrei mit dem Rest zwischen beide Rümpfe zu geraten. Brett gibt Vollgas, laut röhren die zwei PS des Außenbordmotors. Steuern lässt sich unser Gespann so nicht! Wir laden um, jetzt liegt unser Mast quer über nur einem Dingi. So erreichen wir sicher das Ufer.
Nach fast 40 Jahren Sonne, Regen, Schnee und Salzwasser, haben sich die Verklebungen zwischen den Holzleisten unseres Mastes gelöst. In mühevoller Arbeit müssen wir den Mast in alle seine Einzelteile zerlegen, anschließend beschädigte Stellen reparieren und für das erneute Kleben vorbereiten. Mit Hilfe von unseren irischen Freunden Pip und Laurence können wir, nach drei Wochen, die ersten Teile wieder zusammen kleben. Doch die größte Schwierigkeit bereitet uns das Wetter. Eigentlich braucht Epoxydharz zur Verarbeitung trockene Luft. Doch in Brasilien ist Regenzeit, die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 80 und 90% und es schüttet ohne größere Unterbrechung.
Zu unserem Glück haben wir in Brians Bootswerft einen relativ trockenen Arbeitsplatz unter einem löchrigen Wellblechdach gefunden. Brain ist vor über 20 Jahren hier selber mit dem Segelboot angekommen und hat die Werft am Fluss gegründet. Seine Hilfsbereitschaft ist wohl der Grund, dass sich so viele Segler in Jacare treffen.
So bald der Mast fertig ist, brennen wir darauf wieder zu segeln. Wir haben genug vom Regen und trüben Wasser Brasiliens. Wir freuen uns auf die Karibik und Sonnenschein.
Die Karibik
Die Karibik
Französisch Guyana
Degras des Cannes, Französisch Guyana, 14
Sechs Knoten, sieben Knoten und schließlich p.08.05hantastische acht Knoten zeigt das GPS. Zu verdanken haben wir diese rauschende Fahrt dem Brasilstrom, der uns mit durchschnittlich zwei Knoten unterstützt. Der Bug zeigt noch Nordwest, unser Ziel heißt Französisch Guyana. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, 1300 Seemeilen liegen vor uns.
Nach sechs Monaten Brasilien müssen wir das Land verlassen, ob wir wollen oder nicht, unsere Visa sind abgelaufen. Der Abschied von Brasilien, seinen sympathischen Einwohnern und unseren Freunden fällt uns schwer.
Sascha hat in Jacare eine neue Antenne für unser Kurzwellenfunkgerät gebaut, so können wir mit den anderen Seglern in Kontakt bleiben. Auch mit den Stationen von Intermar, dem deutschen Amateur- Seefunknetz, sprechen wir jetzt täglich. Wir geben unsere Position durch und werden mit dem Wetterbericht versorgt.
"Das darf doch nicht wahr sein, ist das nicht ein Ruderboot?" Hundert Meilen vor der Küste kann es sich doch nur um einen Schiffbrüchigen handeln. Als wir das Boot mit zehn Meter Abstand passieren, winkt uns der vermeintlich Schiffbrüchige mit einem großen Fisch zu. Wir haben jedoch keine Zigaretten zum Tausch und sind viel zu schnell, so dass aus der Fischmahlzeit nichts wird.
Beim Weitersegeln tauchen immer mehr dieser Einmannruderboote auf. Wir müssen schon genau hinsehen, um sie zwischen den Wellen zu entdecken. Ganz am Schluss sehen wir das große Mutterschiff, das, am Ende des Tages, hoffentlich alle wieder einsammeln wird. Wir möchten nicht wissen, wie viele von diesen mutigen Fischern für immer auf See bleiben.
Nach neun Tagen auf See laufen wir in das Mündungsdelta des Oyapock ein. Als wir das Echolot einschalten, kriegen wir einen Schreck, 2,50m Wassertiefe, Tendenz sinkend. "10 Grad Steuerbord, noch mal 5 Grad Steuerbord!" 1,50m, 1,40m nach einer bangen Viertelstunde wird es wieder tiefer. Der Oyapock ist der Grenzfluss zwischen Brasilien und Französisch Guyana. Wir möchten jedoch den Ouanary, einen Nebenfluss, erkunden. Trotz GPS-Wegpunkt ist es gar nicht so einfach die richtige Einfahrt zu finden.
Und plötzlich befinden wir uns mitten im Dschungel. Wir ankern vor einem verfallenen Steg. Ein mit Kokosnusspalmen bewachsener Pfad führt zu einer Ansiedlung. Schon von weitem hören wir das Geknatter eines Dieselmotors, der den Ort mit Strom versorgt. In der "Dorfkneipe", eine Terrasse eines Hauses, treffen wir den Bürgermeister und ein paar Einwohner. Mit unseren geringen Französischkenntnissen bringen wir in Erfahrung, dass es eine Schule, aber keinen Bäcker und kein Geschäft gibt. Kaufen kann man hier nichts. Wir fragen uns, wovon die Bewohner leben und was sie den ganzen Tag machen.
Weiter geht es flussaufwärts. Eine undurchdringliche grüne Mauer säumt die Ufer. Laut schimpfend fliegen Schwärme von Papageien über uns hinweg. Wenn man Glück hat, sieht man die Affen von Baum zu Baum springen. Beim Dingiausflug scheuchen wir einen Kaiman auf. Nach ein paar Tagen freuen wir uns wieder auf die Zivilisation, unser nächster Stopp heißt Degras des Cannes in der Nähe von Cayenne.
Tobago
Store Bay, Tobago
Das sind wir nicht mehr gewöhnt. Nach vielen ruhigen Flusstagen, werden wir jetzt vom Schwell durchgeschaukelt. Wir ankern vor den berühmten Ile de Salut, den Teufelsinseln vor der Küste Französisch Guyanas. Mit dem Dingi rudern wir an Land, um die größte Insel, die Ile Royal, zu erkunden. Bei tropisch heißen Temperaturen erreichen wir, mit enormem Schweißverlust, den höchsten Punkt der Insel. Belohnt werden wir mit einem grandiosen Ausblick auf die beiden anderen Inseln des Archipels, die Ile de Diable und die Ile de Saint Joseph. Wir finden ein offenes Gebäude, es beherbergt ein kleines Museum. Auf staubbedeckten Wandtafeln informieren wir uns über die nicht gerade ruhmreiche Geschichte der Inseln. Bis 1954 wurden hier Menschen unter unwürdigen Bedingungen gefangen gehalten. Die Lebenserwartung der Sträflinge betrug nur wenige Jahre. Eine Flucht war angeblich wegen der Haie, wohl aber eher wegen der starken Strömung, unmöglich. Heute wohnen hier hauptsächlich exotische Tiere. Auf dem Rückweg sehen wir Aras, Iguanas und ein Tier, das aussieht wie eine Mischung aus einem Ferkel und einer Ratte.
In der Hoffnung auf eine ruhige Nacht, motoren wir die 200m bis zur Ile de Saint Joseph. Hier finden wir im dichten Dschungel die Überreste des Gefängnistraktes. Ein kalter Schauer läuft uns beim Anblick der Zellen über den Rücken. Dicht an dicht reihen sich die winzigen Räume in endlosen Gängen. An Stelle eines Daches gibt es nur ein Gitterrost, durch das die Wärter die Insassen kontrollieren (und schikanieren) konnten. Inzwischen wachsen überall Bäume und kräftige Wurzeln sprengen die Mauern. In einigen Jahren wird wohl nichts mehr zu sehen sein.
Für die Fahrt nach Tobago laden wir uns das Boot noch mit Kokosnüssen voll, deren köstliches Wasser uns mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgen soll.
Die Silhouette der Inseln ist noch nicht am Horizont verschwunden, als wir mit Intermar in Deutschland funken. „Wind 10 – 15 Knoten aus Südost, für die nächste Zeit habt ihr optimale Bedingungen“, teilt uns Rolf mit. Gerade wollen wir uns verabschieden, da meint Rolf: „Moment mal, in der Karibik könnte sich ein neuer Hurrikane bilden.“ Wir überlegen, ob wir einen Zwischenstopp in Surinam machen sollen. Als wir jedoch am folgenden Tag die neuen Wetterprognosen von Intermar bekommen, entschließen wir uns zu einer anderen Taktik. Um unsere Fahrt zu verlangsamen binden wir zwei Reffs ins Groß und bergen die Genua. Zwei Tage später hat sich die Depression verzogen und wir setzten wieder alle Segel.
„Verdammt“, schnell verschwindet die Dichtung unseres brasilianischen Dampfdrucktopfes im Kielwasser. Beim Spülen, wir hängen das Geschirr außenbords, hat Sascha nicht an den Gummiring gedacht. Glücklicherweise haben wir abends die Funkrunde mit den Seglern in Brasilien. Michael und Sylvia versprechen uns ein entsprechendes Ersatzteil mit nach Tobago zu bringen.
Nach sieben Tagen taucht am Horizont unsere erste Karibikinsel auf. Die Ankunft müssen wir dieses Mal genau timen, da Zoll und Einwanderungsbehörde nur von 8 – 16 Uhr geöffnet haben und man am Wochenende eine Überstundengebühr von 50 US-Dollar bezahlen muss.
Nach dem wir die Formalitäten erledigt haben, können wir am nächsten Tag endlich unsere Freunde Heinz und Andrea wieder treffen die wir zuletzt auf den Kapverdischen Inseln gesehen haben.
Bonaire
Sonntag, der 8. Januar, langsam manövriert sich der große, graue Stahlrumpf des Küstenpolizeiboots durch das Feld der, etwa 80, Ankerlieger in Porlamar. Ihr Ziel ist Hennings Boot (Name geändert). Fünf Polizisten in Zivil entern die kleine deutsche Yacht. Mittlerweile haben sich die benachbarten Crews fast vollständig auf ihren Decks versammelt, mit und ohne Fernglas wird das Geschehen verfolgt. Nur Heinz reagiert, springt ins Wasser und schwimmt zu Henning. "Was geht hier vor? Sollen wir die Deutsche Botschaft anrufen?" (Bei den Behörden hier weiß man nie!) Doch Henning ist viel zu geschockt, um auf das Angebot eingehen zu können. So müssen wir mit ansehen, wie die Yacht in Schlepp genommen wird und Richtung nächstem Hafen verschwindet.
Am folgenden Morgen können wir in der Zeitung lesen, dass Henning 147kg Kokain, versteckt in Lebensmitteldosen, an Bord hatte. Wir haben Henning das erste Mal in Brasilien getroffen, hier endet für ihn wohl die Blauwasserfahrt. Das Boot liegt an der Kette und er bleibt für mehrere Jahrzehnte hinter venezolanischen Gittern.
Bevor wir den Pazifik erobern, wollen wir Sarei noch mal einen neuen Unterwasseranstrich gönnen. Wir recherchieren im Internet und studieren die unterschiedlichen Preise. Schließlich entscheiden wir uns für eine kleine Werft in Cumana auf dem venezolanischen Festland. Als wir, nach zwei Segeltagen, in dem Vorhafen des Betriebes ankern, sagt man uns: "Vier Dollar pro Fuß für den Kran ist schon richtig, aber ihr müsst mindestens für 35 Fuß bezahlen!" Das stand so nicht im Internet! Wir sind entsetzt und wollen den Chef sprechen: "Jetzt segeln wir schon mit so einem kleinen Schiff und sollen auch noch dafür bestraft werden?" Nachdem wir ihm die Situation erklärt haben, reagiert er kulant und wir bezahlen für nur 29 Fuß.
Nach drei Arbeitstagen mit viel Schleifen, Streichen und Schwitzen glänzt Sarei im neuen Gewand.
Auf dem Weg nach Bonaire wollen wir und noch, für drei Wochen, auf den traumhaften Inseln Venezuelas entspannen. Eine Nachtfahrt bringt uns nach Isla Tortuga. Dort bekommen wir unseren ersten Eindruck vom Paradies: weißer Sandstrand, türkises Wasser und strahlend blauer Himmel. Die Intensität der Farben ist so stark, dass sogar die Möwen über uns grüne Bäuche haben. Gemeinsam mit einem französischen Pärchen wollen wir noch einen zweiten Ankerplatz erkunden. Für die zehn Meilen nehmen wir das Dingi in Schlepp. Womit wir nicht gerechnet haben, ist der extrem hohe Seegang von 3-4m Wellenhöhe. Da geht ein Ruck durchs Boot. Sascha schaut nach hinten und wird blass. Mit dem Bauch nach oben bleibt das Beiboot hinter uns zurück. "Boot über Bord!" Mit dem gelernten und entsprechend oft geübten "Mensch-über-Bord-Manöver" versuchen wir den Ausreißer wieder einzufangen. Ohne Motor, bei Windstärke 6 und diesem Seegang ist das ein echtes Problem. Das Boot lässt sich nicht stoppen und nimmt auch ohne Segelfläche direkt wieder Fahrt auf. Bei einem Versuch versetzt uns eine Welle und wir rammen das Dingi. Nun klafft auch noch ein großes Loch in seinem Boden.
Zwei Stunden kämpfen wir, bevor das Boot wieder an Deck liegt. Mit blutigen Fingern, blauen Flecken und Schrammen brauchen wir zwei Tage, bis wir wieder zu Kräften kommen.
Für den nächsten Schlag zu den "Los Roques" warten wir deshalb auf besonders schönes Wetter. Die "Los Roques" sind ein Archipel aus Korallenriffen, Inseln und Lagunen. Das gesamte Gebiet ist ein Naturschutzpark. Genaue Seekarten gibt es nicht von der Gegend, und so finden wir unseren ersten Ankerplatz auf Dos Mosquises mit der "Augapfelnavigation". Auf dieser, ca. 1km langen, Sandinsel gibt es eine Schildkrötenstation, die wir besuchen möchten. Wir schwimmen zum Strand, da das Dingi noch nicht einsatzfähig ist. Der Parkranger zeigt uns die Becken mit den kleinen Schildkröten. Bis zu einem Jahr werden sie hier aufgepäppelt, bevor sie in die Freiheit entlassen werden. Anschließend setzten wir uns auf die Veranda seiner Küche. Er erzählt uns, dass er schon seit sechs Jahren auf der Insel lebt. Weitere Bewohner sind ein Fischer, drei Hunde und z.Z. ein Student der Universität Caracas. Zum Abschied bekommen wir Orangen und Limonen geschenkt, so sind wir der Skorbutgefahr gerade noch mal entkommen.
Zum Schnorcheln segeln wir fünf Meilen weiter nach Cayo de Aqua. Diese Insel ist völlig unbewohnt, man fühlt sich wie Robinson.
Letzter Stopp auf dem Weg nach Bonaire sind die "Aves de Borlavento". Aves heißt Vögel, und von diesen gibt es hier unglaublich viele. In riesigen Schwärmen fliegen die Tölpel laut kreischend über den Mangrovenwipfeln.
Ein kleines Fischerboot kommt längsseits: "Zigaretten?" Endlich können wir unsere Stange Zigaretten auspacken, die wir extra für diesen Fall auf Isla Margarita gekauft hatten. Als Dankeschön landet eine Languste in unserem Cockpit. Doch bei der Vorstellung, das große Krustentier lebend in ein Topf kochendes Wasser zu tauchen, wird uns beiden schlecht. Als die Fischer außer Sicht sind, entlassen wir es zurück in die Freiheit. Glücklich verschwindet es, so schnell es kann, in der Tiefe. Zum Abendbrot gibt es Reis ohne Languste.
Bei Mondlicht mit Hilfe des GPS suchen wir uns den Weg aus der Lagune. Am nächsten Morgen heißen uns zwei rosa Flamingos vor Bonaire willkommen. Nach drei Wochen in der Einsamkeit sind wir zurück in der Zivilisation.
Unsere nächste Station sind die San Blas Inseln vor Panama. Bei den Indianern dort gibt es kein Internet, so dass wir und erst wieder in Panama melden können.
Die Südsee und Neuseeland
Die Südsee und Neuseeland
Marquesas
Marquesas, Nuku Hiva, Taiohae
„Wie kriegt man dieses Tier nur ans laufen?“ Ganz unbeeindruckt von unseren Kommandos folgen die Pferde einfach unserem Führer Minimo. Wir sind auf einer Exkursion zum zweitgrößten Vulkankrater der Erde auf Isabela in den Galapagos Inseln. Der Reitweg führt am Kraterrand entlang, doch noch ist die Sierra Negra im dichten Nebel verhüllt. Nach einer guten Stunde binden wir die Pferde im Schatten eines Baumes fest, und gehen den Rest zu Fuß weiter. Während wir über die schwarze, mondähnliche Landschaft wandern, erklärt uns Minimo die verschiedenen Lavastrukturen. „Wann war denn die letzte Eruption?“ Uns wird doch etwas anders zumute, als er antwortet:“ Letzten Oktober vor fünf Monaten“. Auf dem Rückweg haben wir klare Sicht und können den Ausblick genießen.
Jetzt ist es Zeit Abschied von unseren Freunden zu nehmen, die längste Ozeanstrecke liegt vor uns und Sarei. Damit wir uns auch wiedersehen, erzählt uns Pepe die erste Hälfte von einem Witz, die Pointe gibt es dann in der Südsee.
Schnell gewöhnen wir uns wieder an die Routine auf See: kochen, Segelwechsel, drei Stunden schlafen, drei Stunden wachen. Etwas Abwechslung bringt die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland, täglich warten wir gespannt auf den Report der „Deutschen Welle“. Natürlich freuen wir uns wenn Deutschland wieder eine Runde weiter kommt.
So rollt Sarei mit uns vor dem Wind Minute um Minute, Stunde um Stunde, Woche um Woche, bis wir endlich, am Morgen des 27. Tages, Land in Sicht haben.
Schöner kann ein Landfall wohl kaum sein, eingerahmt von einem Regenbogen segeln wir um das Nordende der Insel Fatu Hiva. Über tausend Meter hohe, bizarr geformte Felsformationen bilden eine beeindruckende Kulisse. Unser Ankerplatz liegt in einem Tal, das von dicht grünbewachsenen Hängen umschlossen wird. Abends „wiegen“ uns polynesische Trommelklänge in den Schlaf.
Da nach der langen Fahrt all unser Frischproviant aufgebraucht ist, gehen wir am nächsten Morgen in den Ort, um uns mit Obst einzudecken. Unsere Rucksäcke sind gefüllt mit Tauschobjekten. Da es hier sowieso nichts zu kaufen gibt, sind die Bewohner nicht an Geld interessiert! „Change?“ fragen wir jeden der uns begegnet, bald finden wir eine Familie, die mit uns tauschen möchte. Eingehend werden die Luftpumpe, der Fender, das T-Shirt und die Zigaretten, die wir mitgebracht haben, begutachtet. Bewaffnet mit langen Stangen schwärmt die Familie in den Garten aus, um uns das Obst direkt von den Bäumen zu pflücken. Schwer beladen mit Bananen, handballgroßen Pampelmusen, Papayas, Limonen und Basilikum machen wir uns auf den Heimweg.
Ausgerüstet mit Picknick und Kameras suchen wir uns einen Weg durch den Dschungel zu einem Wasserfall. Dort wo dass Wasser auftrifft, hat sich ein Pool gebildet und wir genießen bei heißen Temperaturen ein Bad im kühlen Süßwasser.
Da wir noch nicht offiziell einklariert haben, dürfen wir nur drei Tage auf Fatu Hiva bleiben.
Eine Tagesreise bringt uns in eine schöne Sandstrandbucht auf der Insel Tahuata. „Guck mal, da liegt Ariel!“ Das kleine Stahlboot mit dem Gaffelrigg ist sch von weitem leicht zu erkennen. Ian und Kathy laden uns zu einem Probesegeln ein, bei gutem Wind können wir das Boot in allen Situationen ausgiebig testen. „Ssssssssssssssssss….“, das Geräusch lässt uns erschreckt zusammenfahren. Es ist jedoch nur die Schleppangel, da hat ein großer Brocken angebissen. Zu dritt kämpfen wir eine halbe Stunde bis der Fisch endlich an Bord ist. Zurück am Ankerplatz präsentieren wir stolz unseren 13 kg Yellowfin- Thunfisch. Natürlich wird der Fang unter allen Seglern aufgeteilt.
Von Tahuata segeln wir nach Ua Pou. Ein junger Mann im Auslegerkanu paddelt an unser Boot heran. „Ich möchte euch gerne in mein Haus einladen.“ Mit einem Geländewagen fahren wir zu seinem Zuhause mit tollem Ausblick über die Bucht. Wir kommen gerade richtig zum Mittagessen. In der „Open-air-Küche“ probieren wir polynesische Köstlichkeiten wie Brotfurcht, getrockneten Fisch und Manjokcreme. Gegessen wird ganz traditionell mit den Fingern direkt aus der Schüssel. Nachdem wir uns ins Gästebuch eingetragen haben, werden wir zurück zur Pier gefahren.
Wir wollen rechtzeitig zum Nationalfeiertag, dem 14. Juli, in Nuku Hiva, der Hauptinsel der Marquesas, sein. Schöne Polynesierinnen mit Blumenkette um den Hals und Blüte im Haar bezaubern uns mit ihren verführerischen Tänzen. Mit einem Mal wird uns klar, warum die Besatzungen der alten Rahsegler gerne für immer hier bleiben wollten. Die kräftigen, kunstvoll tätowierten Männer wettstreiten unterdes im Kanu- und Pferderennen.
Doch in der Südsee gibt es noch viel mehr zu entdecken, deshalb wollten wir auf dem Weg nach Tahiti einen Zwischenstopp auf den Tuamotus einlegen.
Tonga
Naiafu, Vava´u, Königreich Tonga
Die Wolken scheinen türkisgrün von den Reflexionen in der Lagune von Bora Bora. Langsam gleiten wir an Korallen und Riffen vorbei. Kaum ist der Anker gefallen, erkunden wir mit Schnorchel und Flossen die Unterwasserwelt. Umringt von einem Schwarm bunter Fische entdecken wir Muränen, Stachelrochen und Picassofische.
Abends treffen wir uns mit unseren Freunden von der „Tradewind“ und der „Pelikaan“ und grillen am Strand unter Palmen Hähnchen und Brot.
Trotz dieser paradiesischen Zustände müssen wir weiter ziehen.
Fünf Segeltage westlich wartet unser nächstes Ziel „Aitutaki“ in den Cookinseln.
„Rückwärts!“, ruft Amrei Sascha zu, doch es ist bereits zu spät. Wir sitzen in der Einfahrt von Aitutaki fest. Bald sind wir wieder frei und der Anker fällt in dem Hafenbecken von Ureia. Hier können wirklich nur sehr kleine Boote rein fahren, weshalb die Insel nur selten angelaufen wird.
Auf einem Motorrad kommt der „Healthofficer“ angebraust, um uns zu klarieren. Wir sitzen auf einem großen Stein unter freiem Himmel und füllen die zahlreichen Formulare aus. „Wer auf diesem Marae (heiliger Stein) getreten ist, ist nicht länger ein Fremder“, erklärt uns Iti, der Beamte. Im Dorf werden wir überall freundlich gegrüßt. Auf Anhieb fühlen wir uns sehr wohl in Aitutaki.
„Good morning, friends“, skandieren die SchülerInnen der fünften Klasse, der Secondary School auf der Insel, als wir den Klassenraum betreten. Sascha wollte mal wieder den Duft einer Schule einatmen. Hier riecht es jedoch ganz anders als in Deutschland. Die LehrerInnen tragen Blumenkränze im Haar, Türen und Fenster stehen weit offen und auf dem Schulhof wachsen Gras und Mangobäume. Zwischen Mathe und Englisch wird getanzt und gesungen. Davon dass die Cookislander gute Sänger sind, können wir uns auch am folgenden Sonntag in der Kirche überzeugen. Wir haben den Eindruck, dass Gottes Segen im direkten Zusammenhang mit der Lautstärke des Gesangs steht. Zwei- oder mehrstimmig dröhnt es von den Wänden wieder. Doch das Wichtigste ist, wie uns der Pastor von der Kanzel mitteilt, die „Sunday School“ nach der Messe. Dabei handelt es sich um eine lange Tafel, die unter Obst-, Sandwich- und Kuchenbergen zusammen zu brechen droht. So lockt man also seine Schäfchen in den Gottesdienst!
Nach eineinhalb Wochen schlüpfen wir aus dem flachen Pass in den tiefen Pazifik. Bei Sonnenschein und leichtem achterlichem Wind genießen wir das Segeln. Wir haben den Kurs Richtung Tonga abgesteckt und freuen uns schon darauf viele Freunde wieder zu treffen. Als wir in die Vava´u-Gruppe im Königreich Tonga einlaufen, steht in unserem Logbuch Samstag der 14.10., doch in Tonga ist es, laut Kalender, schon Sonntag der 15. Oktober. Wir haben die Datumsgrenze passiert, wären wir einen Tag schneller gewesen, hätten wir uns Freitag den 13. sparen können!
Um nicht Überstundengebühr bezahlen zu müssen, verbringen wir eine Nacht vor Anker, bevor wir am nächsten Morgen zum Einklarieren nach Neiafu fahren.
Es hält uns nicht lange in der Stadt. Nachdem wir uns auf dem Markt mit frischen Vitaminen versorgt haben, die Wäsche gewaschen ist und wir einmal ausgeschlafen haben, ziehen wir los, um die vielen schönen Ankerplätze zu erkunden. Die Landschaft erinnert uns an die schwedische Schärenküste.
Heute wollen wir am „Ano Beach“ an einem „Tongan Feast“ teilnehmen. „Das sieht ja aus wie Abwaschwasser und schmeckt auch so!“ Zur Begrüßung bekommen wir Kawa in einer Kokosnussschale, das traditionelle, rauschhaltige Getränk.
Mit ca. 20 anderen Seglern sitzen wir auf Strohmatten und genießen auf tonganische Art zubereitete Speisen. Es gibt keine Schüsseln, Pfannen, Teller oder Besteck. Das Essen, über Stunden im Erdofen gegart, ist in Bananenblättern eingewickelt oder wird in Kokosnuss- und Papayaschalen serviert. Gegessen wird mit den Fingern. Natürlich geht es auch hier nicht ohne Tanz und Gesang. Dieses Mal bestaunen wir einen „Wardance“ (Kriegstanz).
Als wir in unser Dingi steigen sinkt es fast, so haben wir uns die Bäuche voll geschlagen.
Nur einen Tag später geht das Feiern weiter. Sascha hat Geburtstag und veranstaltet einen „Potluck“ am Strand (jeder bringt etwas zu Essen mit).
Von der bunten Gemeinschaft hört Sascha Geburtstagsständchen auf Deutsch, Englisch, Schwedisch und Chinesisch.
Die Cyclonsaison steht vor der Tür und für uns wird es langsam Zeit auf unsere letzte, große Etappe Richtung Neuseeland zu gehen.
Neuseeland
Opua, Bay of Islands, Neuseeland
„Hier wachsen unsere Kürbisse, das ist der Mangobaum, die Bananen werden wohl nächste Woche reif und auf unsere Weinrebe sind wir ganz besonders stolz.“ Zwischen den Pflanzen haben große tropische Spinnen ihre Netze gespannt.
Elke und Werner aus Deutschland haben sich ihren Südseetraum erfüllt und leben auf einer, sonst unbewohnten, Insel in Tonga. Anstelle eines Vorgartens haben sie einen paradiesischen Sandstrand zur Lagune. Bei einem Glas selbstgepresstem Mandarinensaft sitzen wir auf der Terasse vor dem, mit Bananenblättern gedecktem, Haus. Den Strom liefern Solarzellen und vom Dach wird das Regenwasser für die tägliche Dusche aufgefangen.
Mit unserem Besuch bei Elke und Werner geht unsere Zeit in der Südsee zu Ende. Wir setzen Segel für die letzte große Etappe nach Neuseeland. Auf dem Weg dorthin wartet noch ein weiteres „Highlight“ auf uns. Am Morgen des vierten Tages fällt der Anker. Doch es ist kein Land in Sicht. Wir drehen uns einmal um uns selbst und sehen doch nur weiten pazifischen Ozean. Wir befinden uns in der Lagune von Minerva Nord. Das schützende, ringförmige Riff ist komplett vom Wasser überflutet. Nur bei Ebbe tauchen die Spitzen der Korallen für kurze Zeit aus dem Meer auf. An der Außenkante fällt der Meeresboden auf 5000m ab. Wir sind das einzige Boot und uns ist etwas unheimlich zumute.
Die Wettervorhersage ist gut und wir setzen Kurs Neuseeland. Kaum haben wir den Pass hinter uns gelassen dröhnt es uns laut in den Ohren. Ein großes Orion-Flugzeug der neuseeländischen Küstenwache überfliegt uns mehrmals in geringer Höhe und wir werden über Funk aufgefordert uns zu melden. „Habt ihr Tiere oder Waffen an Bord?“ „Hattet ihr unterwegs Kontakt zu anderen Booten?“ Und vieles mehr wollten die Neuseeländer wissen. Unglaublich! Um das alles zu erfahren, fliegen sie uns doch tatsächlich 1500 km entgegen.
Nach einigen schönen Segeltagen, wir sind schon fast da, haben wir keinen Wind mehr. Wir holen die große Genua raus, bemüht jeden Luftzug auszunutzen. Meist kommt der auch noch aus der falschen Richtung. Unsere Nerven sind gespannt, sind wir unserem Ziel doch schon zum Greifen nahe. Ein Blick auf die schwindenden Essenvorräte kann uns auch nicht aufbauen. Aufgrund der Preise und der Auswahl in Tonga haben wir knapp kalkuliert. Zur Abwechslung nehmen wir ein Bad im Pazifik, der so weit im Süden schon ungemütlich kalt ist. Doch irgendwann hat Neptun ein Einsehen mit uns und wir erreichen die wunderschöne „Bay of Islands“.
Betreten dürfen wir Neuseeland erst, wenn der Zollbeamte und der Quarantäneoffizier ihr Okay gegeben haben. Getrocknete Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, Eier und Milchpulver alles wandert in einen großen, schwarzen Sack und wird vernichtet. Eine halbe Stunde später haben wir einen Einreisestempel im Pass und suchen uns einen Platz im Ankerfeld.
Unsere Reisezeit geht so langsam zu Ende und der Geldbeutel ist dünner geworden. Deshalb haben wir uns entschlossen Sarei in Neuseeland zu verkaufen.
Überall platzieren wir Aushänge und auf den ersten Anrufer müssen wir nicht lange warten. Nachdem sich ein Käufer gefunden hat, gilt es noch viel zu organisieren. Wir müssen das Boot importieren, ein Gutachter kontrolliert das Unterwasserschiff und gleichzeitig suchen wir nach einem Kleinbus, unserem neuen Zuhause. In Auckland finden wir einen Toyota „LiteAce“, der für unsere Zwecke genau richtig ist. Denn wir haben vor, Neuseeland in den nächsten Monaten vom Nordkap bis zur Südspitze der Südinsel zu erkunden. Natürlich werden wir auch über diese Abenteuer weiter berichten.